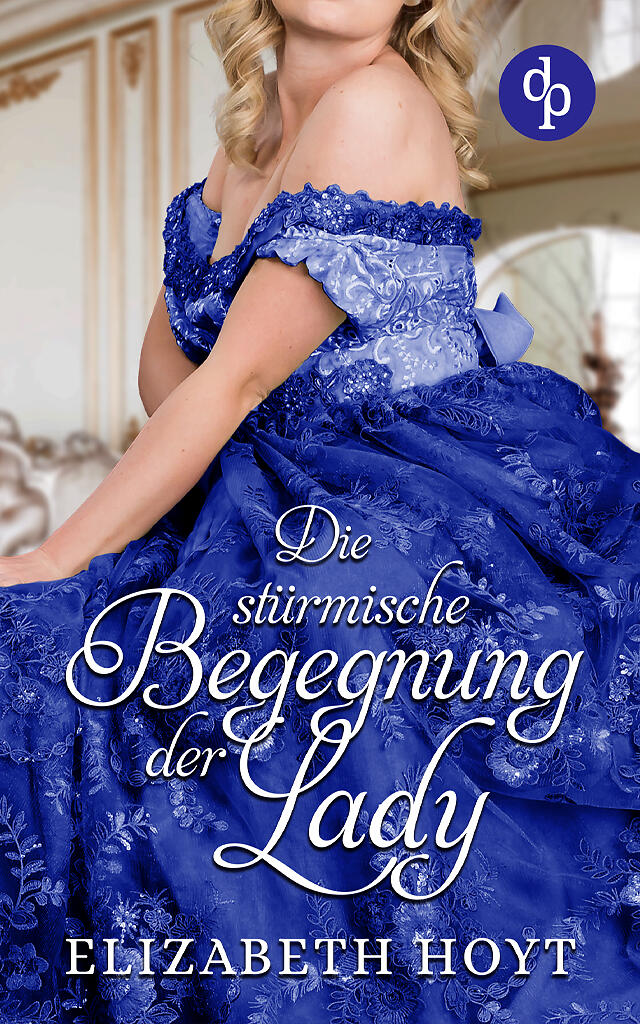1. Kapitel
Longswords Schwert war kein gewöhnliches, denn seine Klinge war nicht nur lang und tödlich scharf, es konnte auch von keinem anderen geführt werden als von Longsword selbst.
Aus der Legende von Longsword
London, Oktober 1765
Wohl wenige Ereignisse sind so langweilig wie ein politischer Salon. Die Gastgeberin einer solchen Geselligkeit wünscht sich bisweilen nichts sehnlicher, als dass etwas – irgendetwas – geschehen möge, das für ein wenig Aufregung sorge.
Wenngleich das plötzliche Auftauchen eines Toten im Salon dann vielleicht doch ein wenig zu viel der Aufregung war, dachte Beatrice Corning im Nachhinein.
Bis zum Auftauchen des Toten hatte alles seinen gewohnten Lauf genommen. Will sagen, es war sterbenslangweilig. Beatrice hatte den Blauen Salon gewählt, der, man ahnt es schon, blau war. Ein helles, beruhigendes, langweiliges Blau. Weiße Pilaster säumten die Wände und reckten die dezent verschnörkelten Kapitelle zur Decke. Tische und Stühle standen im Raum verteilt, in der Mitte des Salons ein großer ovaler Tisch, auf dem, um eine Vase üppiger Astern herum, das Büffet angerichtet war.
Die Erfrischungen bestanden aus hauchdünn geschnittenem Brot, welches ebenso hauchdünn gebuttert war, und kleinen blassrosa Kuchen. Beatrice hatte auf Himbeertörtchen bestanden, die wenigstens ein bisschen Farbe in das Ganze gebracht hätten, aber Onkel Reggie – für alle außer ihr der Earl of Blanchard – hatte sich dem Vorschlag vehement widersetzt.
Beatrice seufzte. Onkel Reggie war schon ein Schatz, aber eben auch ein ausgemachter Geizkragen. Weshalb auch der Rotwein zu einem Rosé verwässert und der Tee so schwach war, dass man bis auf die winzige blaue Pagode am Boden der Tasse hindurchsehen konnte.
Beatrice blickte hinüber zu ihrem Onkel, der die kräftigen, krummen Beine in den Boden gestemmt dastand, die Hände auf den Hüften, und sich ein hitziges Wortgefecht mit Lord Hasselthorpe lieferte. Wenigstens hielt ihn das davon ab, sich an den Kuchen gütlich zu tun, und Beatrice hatte bereits im Vorfeld Sorge getragen, dass ihm das Weinglas nicht mehr als einmal gefüllt wurde. Im Eifer des Gefechts war Onkel Reggies Perücke in Schieflage geraten. Ein Lächeln stahl sich auf Beatrice’ Lippen. Ihr Onkel war einfach unverbesserlich. Sie winkte einen der Diener herbei, gab ihm ihren Teller und bahnte sich ihren Weg durch den Salon, um den Earl of Blanchard wieder präsentabel zu machen.
Doch eine leichte Berührung am Ellenbogen und ein vertrauliches Flüstern ließen sie auf halbem Weg innehalten. „Nicht hinschauen, aber Seine Gnaden gibt gerade wieder seine Imitation eines cholerischen Karpfens zum Besten.“
Beatrice drehte sich um und schaute in sherrybraune, vergnügt funkelnde Augen. Lottie Graham war klein und korpulent, hatte dunkles Haar und ein rundes, sommersprossiges Gesicht, das nicht ahnen ließ, welch gewitzter Geist sich dahinter verbarg.
„Nein, tut er nicht“, wies Beatrice sie leise zurecht und wünschte, sie hätte den Rat ihrer Freundin befolgt. Doch zu spät, schon hatte sie einen kurzen Blick auf Seine Gnaden geworfen, und wie immer hatte Lottie ganz recht – der Duke of Lister hatte eine geradezu frappante Ähnlichkeit mit einem sich echauffierenden Fisch. „Und überhaupt, was sollte im Leben eines Karpfens Anlass geben, sich derart zu erregen?“
„Eben“, meinte Lottie, als habe sie es schon immer gewusst. „Ich mag diesen Mann nicht – habe ihn noch nie gemocht –, und das liegt keineswegs nur an seinen politischen Ansichten.“
„Schsch“, zischte Beatrice. Sie waren zwar unter sich, doch mit etwas gutem Willen hätte einer der in der Nähe stehenden Gentlemen ihre Unterhaltung mitanhören können. Und da alle der anwesenden Herren überzeugte Torys waren, taten die Damen gut daran, ihre Sympathien für die Whigs für sich zu behalten.
„Ach, Beatrice, meine Liebe“, sagte Lottie, „selbst wenn einer dieser feinen, gelehrten Herren mich gehört hätte, würde wohl keiner von ihnen auf die Idee kommen, dass ich es ernst gemeint haben könnte. Unsere hübschen Köpfe sind doch nicht zum Denken da – noch dazu zum Denken von Gedanken, die den ihren entgegenstehen.“
„Sieht auch Mr Graham das so?“
Die beiden jungen Damen richteten ihr Augenmerk auf einen gut aussehenden jungen Mann mit schneeweißer Perücke, der in einer Ecke des Salons stand. Seine Wangen waren rosig, seine Augen strahlend und klar, und er hielt sich stolz und aufrecht, während er die um ihn versammelten Herren mit irgendeiner Anekdote erheiterte.
„Leider ja“, sagte Lottie und maß ihren Gatten stirnrunzelnd.
Beatrice neigte sich ihrer Freundin zu. „Aber ich dachte, du wärest auf dem besten Wege, ihn für unsere Seite zu gewinnen?“
„Da muss ich mich wohl getäuscht haben“, meinte Lottie. „Was den Torys Wunsch ist, ist Nate Befehl, ganz gleich, ob er mit ihren Ansichten d’accord geht oder nicht. Er hält seine Nase in den Wind und hat das Rückgrat einer kleinen Springmaus. Nein, ich fürchte, dass er gegen Mr Wheatons Gesetzesvorlage zur Versorgung ehemaliger Soldaten Seiner Majestät stimmen wird.“
Beatrice biss sich auf die Lippe. Lottie sagte das so leichthin, aber sie wusste, wie enttäuscht ihre Freundin war. „Das tut mir leid.“
Lottie zuckte mit den Schultern. „Wie seltsam es doch ist, dass ein Gatte, der so wankelmütig in seinen Anschauungen ist, mich weitaus mehr enttäuscht als ein Mann, der völlig konträre Ansichten zu den meinen mit großer Leidenschaft verträte. Ist das nicht schrecklich widersprüchlich von mir?“
„Nein, es ist nur Beweis deiner eigenen leidenschaftlichen Überzeugungen.“ Beatrice hakte sich bei Lottie unter. „Außerdem würde ich Mr Graham noch nicht verloren geben. Er liebt dich, musst du wissen.“
„Oh, das weiß ich.“ Lottie begutachtete die kleinen rosa Kuchen vor sich auf dem Tisch. „Das macht die Sache nur umso tragischer.“ Sie ließ einen der Kuchen in ihrem Mund verschwinden. „Mmmm“, machte sie. „Die sind viel besser, als sie aussehen.“
„Lottie!“, rief Beatrice lachend.
„Aber sieh sie dir doch an – es sind so kleine, blasse, wohlanständige Tory-Kuchen, dass ich dachte, sie würden staubtrocken sein, aber sie sind köstlich. Und so reizend rosa.“ Sie ließ sich noch einen munden. „Dir ist schon aufgefallen, dass Lord Blanchards Perücke verrutscht ist?“
„Ja, ist es“, seufzte Beatrice. „Ich war gerade auf dem Weg, sie wieder zu richten, als du mir in die Quere gekommen bist.“
„Du Arme. Jetzt musst du es auch noch mit dem alten Fischkopf aufnehmen.“
Beatrice sah, dass der Duke of Lister sich zu ihrem Onkel und Lord Hasselthorpe gesellt hatte. „Ach herrje. Aber es hilft nichts, ich muss Onkel Reggies Perücke retten.“
„Welch tapfere Seele doch in deiner Brust schlummert“, meinte Lottie. „Ich bleibe derweil hier und passe auf die Kuchen auf.“
„Feigling“, brummte Beatrice.
Mit einem Lächeln auf den Lippen machte sie sich abermals auf zum kleinen Kreis ihres Onkels. Lottie hatte natürlich ganz recht. Die Gentlemen, die sich im Salon ihres Onkels versammelt hatten, waren die führenden Größen der Tory-Partei. Die meisten hatten ihren angestammten Platz im Oberhaus, doch es fanden sich auch Bürgerliche in ihren Reihen, wie beispielsweise Nathan Graham.
Allesamt wären sie empört – um nicht zu sagen, entsetzt –, wüssten sie, dass sie selbst politische Ansichten hatte, noch dazu solche, die jenen ihres Onkels zuwiderliefen. Für gewöhnlich behielt sie diese Ansichten daher für sich, aber die Frage einer gerechten Altersversorgung ehemaliger Soldaten war zu bedeutsam, als dass man dazu hätte schweigen können. Beatrice hatte mit eigenen Augen gesehen, was der Krieg bei einem Menschen anrichten konnte – auch noch Jahre, nachdem er aus der Armee Seiner Majestät ausgeschieden war. Es war verheerend, und darum …
Die Tür des Salons wurde so ungestüm aufgestoßen, dass sie gegen die Wand knallte. Alle drehten die Köpfe nach dem Mann, der dort stand. Er war groß, mit unglaublich breiten Schultern, die fast die ganze Tür einnahmen. Er trug einen blauen Rock, darunter ein Hemd, und an den Beinen seltsame Lederstulpen. Langes schwarzes Haar fiel ihm wild und ungezähmt den Rücken hinab, und ein zerzauster Bart bedeckte fast vollständig seine eingefallenen Wangen. Ein Kreuz aus Metall baumelte von einem Ohrläppchen, und von einem groben Seil um seine Hüfte, das ihm als Gürtel dienen mochte, hing ein Messer mit nackter Klinge herab.
Seine Augen waren so dunkel und leblos wie die eines Toten.
„Was zum Teufel …“, setzte Onkel Reggie an.
Aber der Mann übertönte ihn mit tiefer, brüchiger Stimme. „Où est mon père?“
Er starrte Beatrice an, als wäre außer ihr niemand im Raum. Wie gebannt stand sie da, fasziniert und verwirrt zugleich. Mit einer Hand tastete sie nach dem Tisch hinter sich, um Halt zu finden. Es konnte doch unmöglich …
Jetzt kam er geradewegs auf sie zu, entschlossenen Schrittes, anmaßend, voller Ungeduld. „J’insiste sur le fait de voir mon père!“
„Ich … ich weiß nicht, wo Ihr Vater ist“, stammelte Beatrice. Fast war er schon bei ihr, nur ein paar Schritte trennten sie noch voneinander. Warum unternahm denn niemand etwas? Und ihr Schulfranzösisch hatte sich bei all der Aufregung zudem verflüchtigt. „Bitte, ich weiß wirklich nicht …“
Aber da stand er auch schon vor ihr, streckte seine großen, groben Hände nach ihr aus. Erschrocken wich Beatrice zurück, sie konnte nicht anders. Ihr war, als wäre der Leibhaftige gekommen, um sie zu holen – hier, in ihrem Zuhause, und noch dazu auf dieser langweiligsten aller Geselligkeiten.
Doch mitten in der Bewegung hielt er inne, taumelte und griff mit einer braun gebrannten Hand nach dem Tisch, als suche auch er Halt, doch das elegante Möbel war ihm nicht gewachsen. Er riss es mit sich, als er zu Boden ging. Eine Blumenvase zersprang neben ihm in Tausend Stücke, Wasser ergoss sich auf den Teppich, überall lagen Blütenblätter und Scherben. Der Blick des Fremden war noch immer voller Zorn auf sie gerichtet, auch dann noch, als er hintüber auf den Teppich sank. Er rollte die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war, dann kippte sein Kopf zur Seite.
Jemand schrie.
„Gütiger Gott! Beatrice, Liebes, hat er dir etwas getan? Wo in Herrgotts Namen steckt der Butler?“
Beatrice hörte ihren Onkel zwar, war aber bereits neben dem gestürzten Mann auf die Knie gesunken. Das verschüttete Wasser durchnässte ihre Röcke, doch sie merkte es kaum. Zögernd legte sie ihre Hand an seine Lippen und spürte einen leisen Atemhauch. Gott sei Dank! Er lebte. Sie nahm seinen Kopf zwischen ihre Hände und bettete ihn auf ihren Schoß, damit sie sein Gesicht genauer in Augenschein nehmen konnte.
Ihr stockte der Atem.
Der Mann hatte ja Tätowierungen im Gesicht! Drei kunstvoll in die Haut gestochene Vögel kreisten wild und angriffslustig um sein rechtes Auge. Seine Furcht einflößenden schwarzen Augen waren nun zwar geschlossen, doch die dichten dunklen Brauen hatte er noch immer so grimmig zusammengezogen, als wollte er selbst bewusstlos Kritik an ihr üben. Was hatte sie ihm nur getan? Sein Bart war lang und zottelig, doch sein Mund war erstaunlich elegant – feine, feste Lippen, die obere in einem weiten, sinnlichen Bogen geschwungen.
„Meine Liebe, bitte lass doch ab von diesem … dieser Person“, tadelte Onkel Reggie, fasste sie beim Arm und bedeutete ihr aufzustehen. „Die Diener können ihn sonst nicht aus dem Haus entfernen.“
„Sie können ihn nicht aus dem Haus werfen“, sagte Beatrice und starrte noch immer ungläubig in dieses fremde und doch so vertraute Gesicht.
„Mein liebes Mädchen …“
Sie schaute auf. Onkel Reggie war ein Schatz, selbst wenn sein Gesicht rot glühte vor Ungeduld. Wenn er nicht achtgab, würde dieser Zwischenfall ihn das Leben kosten. Und sie … was bedeutete dieser Moment für sie? „Das ist Viscount Hope.“
Onkel Reggie blinzelte verwirrt. „Wer?“
„Viscount Hope.“
Beide blickten sie hinauf zu dem Bildnis neben der Tür. Es zeigte einen gut aussehenden jungen Mann, den einstigen Erben der Grafschaft. Der Mann, dessen Tod Onkel Reggie erst zum Earl of Blanchard gemacht hatte.
Schwarze Augen sahen sie unter schweren Lidern hervor von der Leinwand herab an.
Beatrice betrachtete wieder den Mann, dessen Kopf noch immer schwer in ihrem Schoß ruhte. Seine Augen waren geschlossen, doch sie erinnerte sich ihrer gut. Dunkel waren sie, fast schwarz, und zornig hatten sie gefunkelt, doch es waren ohne jeden Zweifel dieselben Augen wie in jenem Bildnis.
Beatrice’ Herz setzte für einen Schlag aus.
Reynaud St. Aubyn, Viscount Hope, der wahre Earl of Blanchard, lebte noch. Und er war zurückgekehrt.
Richard Maddock, Lord Hasselthorpe, sah zu, wie die Diener des Earl of Blanchard den bewusstlosen Irren aufhoben und aus dem Salon schafften. Wie der Mann am Butler und den Lakaien vorbeigekommen war, dürfte für immer ein Rätsel bleiben. Der Earl sollte mehr Sorge für seine Gäste tragen – in diesem Haus fand sich derzeit immerhin fast die gesamte Elite der Torys versammelt. Bei Gott, welch fahrlässiger Leichtsinn!
„Verdammter Idiot“, knurrte der Duke of Lister und sprach nur aus, was wohl alle dachten, oder zumindest er, Lord Hasselthorpe. „Wenn das Haus nicht sicher ist, hätte Blanchard zusätzliche Wachen anheuern sollen.“
Hasselthorpe schnaubte verächtlich und nippte an seinem ungenießbar verwässerten Wein. Die Diener waren beinahe an der Tür angelangt und hatten sichtlich Mühe, den verrückten Wilden zu tragen. Der Earl und seine Nichte folgten ihnen und unterhielten sich leise. Blanchard warf einen kurzen Blick in seine Richtung, und Hasselthorpe nutzte die Gelegenheit, missbilligend eine Braue zu heben.
Rasch sah der Earl wieder beiseite. Blanchard mochte der Ranghöhere sein, aber Hasselthorpe verfügte über mehr politischen Einfluss – ein Umstand, den Hasselthorpe mit Bedacht einsetzte. Gleichwohl galt es, keine Verbündeten zu verprellen. Und Blanchard war, ebenso wie der Duke of Lister, wohl sein wichtigster Verbündeter im Parlament. Hasselthorpe hatte längst ein Auge auf das Amt des Premiers geworfen, und mit der Unterstützung von Blanchard und Lister hoffte er, seine Ambitionen im nächsten Jahr erfüllt zu sehen.
Wenn alles nach Plan lief.
Die kleine Prozession hatte den Salon verlassen, und Hasselthorpe richtete seinen Blick wieder auf die anderen Gäste. Leicht irritiert runzelte er die Stirn. Jene Gentlemen, die nah der Stelle gestanden hatten, wo der Eindringling gestürzt war, hatten sich zu kleinen Gruppen zusammengefunden und tuschelten mit leisen, aufgeregten Stimmen. Irgendetwas war da im Busch. Man konnte förmlich den Wellenschlag irgendeiner Neuigkeit sehen, die sich in der Menge ausbreitete. Sowie sie eine neue Gruppe erreichte, schossen Augenbrauen in die Höhe, und mit Perücken bedeckte Köpfe wurden zusammengesteckt. Sehr suspekt das alles.
Der junge Nathan Graham stand bei einem Grüppchen nahebei. Graham war frisch gewählter Abgeordneter des Unterhauses, ein ehrgeiziger junger Mann, der über genügend Vermögen verfügte, sich seine Ambitionen leisten zu können. Ein vielversprechender Redner war er zudem. Kurzum, ein junger Mann, auf den man ein Auge haben sollte. Man wusste nie, wann er einem nützlich sein konnte.
Graham löste sich von der kleinen Gruppe und kam zu Hasselthorpe und Lister herüber, die etwas abseitsstanden. „Man sagt, es sei Viscount Hope.“
Hasselthorpe blinzelte verwirrt. „Wer?“
„Der Mann!“ Graham deutete auf die Stelle, wo gerade ein Hausmädchen die Scherben zusammenkehrte und das Wasser vom Boden aufnahm.
Für den Bruchteil einer Sekunde setzte Hasselthorpes Verstand aus.
„Unmöglich“, brummte Lister. „Hope ist seit sieben Jahren tot.“
„Weshalb glaubt man denn, dass es Hope sei?“, fragte Hasselthorpe ruhig.
Graham zuckte ratlos mit den Schultern. „Weil er ihm ähnlich sieht, Sir. Als er hereinkam, stand ich nah genug, um sein Gesicht genau betrachten zu können. Und diese Augen … nun, so etwas sieht man nicht alle Tage.“
„Das will ich wohl meinen“, spottete Lister. „Seine Augen beweisen gar nichts, schon gar nicht, dass er von den Toten auferstanden ist.“
Lister konnte es sich leisten, mit solcher Autorität zu sprechen. Hochgewachsen und mit einem beachtlichen Bauch, gab er eine stattliche Gestalt ab. Zudem war er einer der mächtigsten Männer Englands. Es nahm somit nicht Wunder, dass man ihm zuhörte, kaum dass er das Wort ergriff.
„Gewiss, Euer Gnaden.“ Graham deutete eine Verneigung an. „Aber er hat außerdem nach seinem Vater gefragt.“
Graham brauchte das Offensichtliche nicht auszusprechen, die anderen dachten es auch so: Und wir befinden uns in der Stadtresidenz des Earl of Blanchard – dem Haus seines verstorbenen Vaters.
„Lächerlich“, beschied Lister dennoch, zögerte kurz und fügte mit gesenkter Stimme hinzu: „Wenn das wirklich Hope war, ist Blanchard seinen Titel los.“
Er warf Hasselthorpe einen vielsagenden Blick zu. Wenn Blanchard seinen Titel verlor, verlöre er auch seinen Sitz im Oberhaus – und sie beide einen wichtigen Verbündeten.
Skeptisch betrachtete Hasselthorpe das Bildnis neben der Tür. Hope war ein junger Mann gewesen, vielleicht in seinem zwanzigsten Jahr, als er dafür Porträt gesessen hatte. Das Gemälde zeigte einen vergnügten jungen Burschen, die Wangen blass und makellos, mit rosigem Schimmer, die schwarzen Augen blickten fröhlich und klar. Wenn dieser Irre von eben Hope gewesen war, musste zwischenzeitlich eine gewaltige Veränderung mit ihm vonstattengegangen sein.
Hasselthorpe wandte sich wieder den anderen zu und lächelte mit grimmiger Entschlossenheit. „Ein dahergelaufener Verrückter kann Blanchard nicht einfach seines Rangs entheben. Und bislang scheint niemand beweisen zu können, dass er wirklich Hope ist. Es besteht daher kein Anlass zur Beunruhigung.“
Äußerlich ruhig und gefasst, nippte er an seinem Wein, wissend, dass seinem letzten Satz ein Wort zur Wahrheit gefehlt hatte. Noch. Es bestand noch kein Anlass zur Beunruhigung.
Vier Diener hatte es gebraucht, um Viscount Hope hochzuheben, und selbst jetzt taumelten sie noch unter seinem Gewicht. Beatrice ließ die vier nicht aus den Augen, als sie und ihr Onkel ihnen hinausfolgten. Sie fürchtete, sie könnten den Viscount fallen lassen. Auch wenn ihr Onkel keineswegs glücklich darüber gewesen war, hatte sie ihn dazu überreden können, den Bewusstlosen in eines der ungenutzten Schlafzimmer zu bringen. Onkel Reggie hätte ihn wohl am liebsten hinaus auf die Straße werfen lassen, aber sie betrachtete die Angelegenheit mit mehr Bedacht – und dies keineswegs nur aus christlicher Nächstenliebe, sondern aus der Erwägung heraus, dass, so es sich bei dem Fremden wirklich um Lord Hope handeln sollten, sie sich gewiss keinen Gefallen damit täten, ihn auf die Straße zu setzen.
Die Diener stolperten samt ihrer Last durch die Halle. Hope war zwar schlanker, um nicht zu sagen dünner, als auf seinem Bildnis, aber noch immer ein sehr stattlicher, hochgewachsener Mann. Beatrice erschauerte. Ein Glück, dass er nicht wieder zu Bewusstsein gelangt war, nachdem er sie so finster angesehen hatte. Bei vollem Bewusstsein würden sie ihn wohl überhaupt nicht von der Stelle bekommen haben.
„Viscount Hope ist tot“, brummte Onkel Reggie, während er neben ihr hertrottete. Er klang selbst nicht sonderlich überzeugt. „Seit sieben Jahren tot!“
„Bitte, Onkel, echauffiere dich nicht so“, mahnte Beatrice besorgt. Er mochte nicht gern daran erinnert werden, aber just letzten Monat erst hatte Onkel Reggie der Schlag getroffen – ein Anfall, der gerade noch einmal glimpflich ausgegangen war, sie aber dennoch in Angst und Schrecken versetzt hatte. „Denk daran, was der Doktor gesagt hat.“
„Ach, Unsinn. Mir geht es blendend, da kann der Quacksalber sagen, was er will“, brüstete sich Onkel Reggie. „Ich weiß, dass du ein weiches Herz hast, meine Liebe, aber das kann unmöglich Hope sein. Drei Männer haben geschworen, seinen Tod mit eigenen Augen gesehen zu haben, abgeschlachtet von diesen Wilden in den amerikanischen Kolonien. Und einer dieser Augenzeugen ist Viscount Vale, sein guter Freund aus Kindertagen!“
„Nun, dann müssen die drei Herren sich eben getäuscht haben“, meinte Beatrice. Mit Bangen sah sie, wie die vier Diener sich ächzend die breite Eichentreppe hinaufmühten. Sämtliche Schlafzimmer befanden sich im zweiten Stock des Hauses. „Passt auf seinen Kopf auf!“
„Selbstverständlich, Miss“, erwiderte George, der älteste der Diener.
„Wenn das wirklich Hope ist, muss er den Verstand verloren haben“, schnaufte Onkel Reggie, als sie oben angelangt waren. „Zetert und tobt, noch dazu auf Französisch! Von seinem Vater hat er gesprochen – der seit fünf Jahren tot ist! Ich war doch selbst auf seiner Beerdigung. Oder willst du mir jetzt noch einreden, der alte Earl wäre auch noch am Leben?“
„Natürlich nicht, Onkel“, sagte Beatrice beschwichtigend. „Aber wahrscheinlich weiß der Viscount nicht, dass sein Vater gestorben ist.“
Sie empfand jähes Mitgefühl für den bewusstlosen Mann. Wo hatte Lord Hope all die Jahre gesteckt? Woher hatte er diese seltsamen Tätowierungen? Und weshalb wusste er nicht, dass sein Vater tot war? Bei Gott, vielleicht hatte ihr Onkel doch recht. Vielleicht war der Geist des Viscounts ja zerrüttet.
Onkel Reggie verlieh ihren furchtbaren Gedanken entrüstet Ausdruck. „Der Mann ist verrückt, so viel ist klar. Wahnsinnig, völlig von Sinnen. Wie er auf dich losgegangen ist, ich bitte dich! Möchtest du dich nicht lieber hinlegen? Ich lasse dir ein wenig von dem Konfekt bringen, das du so gern magst. Nein, nein, schon gut. Heute wollen wir mal keine Kosten scheuen.“
„Das ist wirklich sehr lieb von dir, Onkel, aber mir fehlt nichts. Er hat mich ja nicht einmal angerührt“, sagte Beatrice.
„Viel gefehlt hätte aber nicht!“
Mit missbilligendem Blick verfolgte Onkel Reggie, wie die Diener den Viscount ins Rote Gemach brachten. Das Rote Gemach war das zweitbeste Gästezimmer, das sie hatten. Kurz wurde Beatrice von Zweifeln überkommen. Wenn dies wirklich Viscount Hope war, sollte er dann nicht das beste Gästezimmer bekommen statt nur das zweitbeste? Oder war die Frage hinfällig, weil er eigentlich ein Anrecht auf die Gemächer des Earls hätte, welche derzeit – natürlich – von Onkel Reggie belegt wurden? Beatrice schüttelte den Kopf. Die ganze Sache war zu verworren, als dass sie sich in Worte fassen ließ, und fürs Erste würde wohl das Rote Gemach genügen müssen.
„Dieser Mann gehört ins Irrenhaus“, grummelte Onkel Reggie. „Schneidet uns noch allen die Kehle durch, wenn er zu sich kommt. Wenn er zu sich kommt.“
„Nichts dergleichen wird er tun“, sagte Beatrice entschieden und versuchte, sich weder vom hoffnungsfrohen Ton irritieren zu lassen, mit dem ihr Onkel die letzten Worte gesprochen hatte, noch von ihrer eigenen Besorgnis. „Gewiss lag es am Fieber. Sein Gesicht hat geglüht, als ich ihm die Hand an die Stirn legte.“
„Dann muss ich wohl noch einen Arzt rufen lassen.“ Onkel Reggie bedachte Lord Hope mit düsterem Blick. „Und aus eigener Tasche dafür zahlen.“
„Es wäre ein Gebot der Nächstenliebe“, meinte Beatrice und beobachtete bangend, wie die Diener Hope aufs Bett beförderten. Seit er im Salon bewusstlos geworden war, hatte er sich weder gerührt noch einen Laut von sich gegeben. Er würde doch wohl nicht wirklich sterben?
Onkel Reggie schnaubte. „Und meinen Gästen werde ich das auch noch irgendwie erklären müssen. Wahrscheinlich zerreißen sich jetzt schon alle den Mund darüber. Wir werden zum Stadtgespräch, darauf kannst du wetten.“
„Ja, Onkel“, sagte Beatrice sanft. „Wenn du dich jetzt wieder deinen Gästen widmen möchtest … Ich kann hier alles Weitere veranlassen.“
„Bleib nicht zu lange auf und halte dich von diesem Vagabunden fern. Wer weiß, wozu er noch fähig ist, wenn er wieder zu sich kommt.“ Mit einem letzten unheilvollen Blick auf den bewusstlosen Mann stampfte Onkel Reggie aus dem Zimmer.
„Sei unbesorgt“, rief Beatrice ihm hinterher und wandte sich dann den wartenden Dienern zu. „George, bitte kümmern Sie sich darum, dass ein Arzt gerufen wird, falls der Earl es im Eifer des Gefechts vergessen sollte.“ Oder sich der Kosten und eines Besseren besinnt, fügte sie bei sich hinzu.
„Jawohl, Miss.“ George ging zur Tür.
„Oh, und schicken Sie bitte auch Mrs Callahan hinauf, ja, George?“ Beatrice musterte den blassen bärtigen Mann auf dem Bett. Er hatte angefangen, sich unruhig zu bewegen, als wolle er jeden Moment zu sich kommen. „Mrs Callahan weiß sonst auch immer, was zu tun ist.“
„Jawohl, Miss.“ George eilte davon.
Beatrice sah die drei verbliebenen Diener an. „Einer von euch sagt bitte der Köchin, dass sie Wasser warm machen soll, Brandy und …“
Just in diesem Moment schlug Hope die schwarzen Augen auf. Die Bewegung war so plötzlich, sein Blick so durchdringend, dass Beatrice töricht kreischte und zurücksprang. Peinlich berührt von ihrem albernen Verhalten straffte sie die Schultern und eilte zurück ans Bett, als Lord Hope Anstalten machte aufzustehen.
„Nein! Nein, Mylord, Sie müssen im Bett bleiben. Sie sind krank.“ Sie berührte ihn leicht an der Schulter und bedeutete ihm, sich wieder hinzulegen.
Und plötzlich war ihr, als würde sie von einem Wirbelwind erfasst. Lord Hope packte sie grob, zog sie hinunter aufs Bett und warf sich auf sie. Er mochte wohl im Vergleich zu seinem Bildnis etwas abgemagert sein, aber Beatrice kam es dennoch vor, als sei ein Sack Steine auf ihrer Brust gelandet. Sie schnappte nach Luft und starrte in seine schwarzen Augen, die sie aus nächster Nähe zornig anfunkelten. So nah war er ihr, dass sie jede seiner schwarzen, beneidenswert langen Wimpern hätte zählen können.
So nah, dass sie spürte, wie sein schreckliches Messer sich schmerzlich an ihren Leib presste.
Sie versuchte, ihn von sich zu stoßen – sie bekam kaum noch Luft! –, aber er packte ihre Hand und hätte sie fast in der seinen zerquetscht. „J’insiste sur le fait …“
Henry, einer der jungen Diener, schnitt ihm das Wort ab, indem er ihm die kupferne Bettpfanne über den Kopf zog. Lord Hope sank in sich zusammen, sein schwerer Schädel schlug auf Beatrice’ Brust auf. Ganz kurz fürchtete sie, nun endgültig zu ersticken. Doch schon hatte Henry den Viscount beim Kragen gepackt und ihn von ihr gezerrt.
Zitternd holte sie Luft und stand mit wackeligen Beinen auf. Als sie sich nach ihrem Patienten umdrehte, lag er abermals bewusstlos auf dem Bett, sein Kopf hing schlaff zur Seite, seine durchdringenden schwarzen Augen waren wieder geschlossen. Hätte er ihr wirklich etwas angetan? Er hatte so böse gewirkt, so barbarisch, wirklich wie von Sinnen. Was in Gottes Namen war ihm nur geschehen? Sie schluckte, rieb sich die schmerzende Hand und versuchte, sich zu fassen.
George kehrte zurück und wirkte schockiert, als Henry ihm berichtete, was sich eben zugetragen hatte.
„Trotzdem hätten Sie nicht gar so fest zuschlagen zu brauchen“, tadelte Beatrice den jungen Burschen.
„Er hat Ihnen was antun wollen, Miss.“ Henry klang beleidigt.
Mit zitternder Hand prüfte sie, ob ihre Frisur Schaden genommen hatte. „Nun, so weit ist es dankenswerterweise nicht gekommen, wenngleich ich gestehen muss, einen Moment lang wirklich Angst gehabt zu haben. Danke, Henry. Es tut mir leid, ich bin noch ein wenig außer mir.“ Sie biss sich auf die Lippe und warf einen kurzen Blick auf Lord Hope. „George, ich hielte es für ratsam, eine Wache vor dem Zimmer des Viscount zu postieren. Tag und Nacht, wohlgemerkt.“
„Jawohl, Miss“, erwiderte George energisch nickend.
„Es ist zu seinem eigenen Besten wie auch zu dem unseren“, fügte Beatrice leise hinzu. „Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Lord Blanchard nichts von diesem Zwischenfall erfährt.“
„Jawohl, Ma’am“, erwiderte George im Namen aller Diener, auch wenn er keineswegs überzeugt aussah.
In diesem Augenblick kam Mrs Callahan geschäftig herbeigeeilt. „Was ist denn passiert, Miss? Hurley hat behauptet, im Salon wär eben ein Gentleman zusammengebrochen?“
„Da hat Mr Hurley ganz recht.“ Beatrice deutete auf den Mann im Bett. Plötzlich kam ihr ein Gedanke, und gespannt wandte sie sich wieder der Haushälterin zu. „Erkennen Sie ihn?“
„Den da?“ Mrs Callahan rümpfte die Nase. „Nicht, dass ich wüsste, Miss. Ganz schön haariger Geselle, was?“
„Behauptet, er wär Viscount Hope“, ließ Henry sich stolz vernehmen.
„Wer?“, fragte Mrs Callahan entgeistert.
„Der Typ von dem Bild“, klärte Henry sie auf. „Tschuldigung, Miss.“
„Keine Ursache, Henry“, erwiderte Beatrice. „Haben Sie Lord Hope vor dem Tod des alten Earls noch kennengelernt?“
„Nein, tut mir leid, Miss“, sagte Mrs Callahan. „Aber wenn Sie sich erinnern, ich hab erst angefangen, als Ihr Onkel Earl geworden ist.“
„Oh ja, stimmt“, meinte Beatrice enttäuscht.
„So wie eigentlich das gesamte Personal“, fuhr Mrs Callahan fort, „und diejenigen, die geblieben sind … Na ja, die sind jetzt auch weg. Ist ja schon fünf Jahre her, dass der alte Earl verstorben ist, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt wohl, dennoch hatte ich gehofft …“ Sie schüttelte den Kopf. Wie wollten sie mit Sicherheit sagen, wer dieser Mann war, wenn es niemanden gab, der Hope identifizieren konnte? „Aber darauf soll es uns im Moment auch gar nicht ankommen. Ganz gleich, wer er sein mag, es ist unsere Pflicht, gut für ihn zu sorgen.“
Sie gab Anweisungen und verteilte Aufgaben. Bis sie den Arzt konsultiert hatte – Onkel Reggie hatte doch nicht vergessen, nach ihm zu schicken –, die Köchin gebeten hatte, einen nährenden Haferbrei zu kochen, und einen Plan zur Pflege des Patienten aufgestellt hatte, war die politische Gesellschaft längst vorbei. Beatrice ließ Lord Hope – so er es denn war – unter der gestrengen Aufsicht von Henry zurück und begab sich hinunter in den Blauen Salon.
Keine Menschenseele war mehr dort. Nur der noch immer feuchte Fleck auf dem Teppich erinnerte an die dramatischen Ereignisse Stunden zuvor. Einige Momente stand Beatrice dort, starrte auf den Fleck, dann wandte sie sich ab und fand sich unversehens vor dem Bildnis Viscount Hopes.
So jung sah er aus, so sorglos! Sie trat näher, fühlte sich wie immer von einer unsichtbaren, unwiderstehlichen Kraft angezogen. Neunzehn war sie gewesen, als sie dieses Bildnis das erste Mal gesehen hatte. An dem Abend, als sie mit ihrem Onkel, dem neuen Earl of Blanchard, das Haus bezogen hatte. Es war schon sehr spät gewesen. Man hatte sie auf ihr Zimmer geführt, doch die Aufregung des Umzugs, die lange Kutschfahrt, und die Tatsache, in London zu sein, hatten sie keinen Schlaf finden lassen. Bestimmt eine Stunde hatte sie hellwach im Bett gelegen, bis sie schließlich ihren Morgenmantel übergezogen hatte und nach unten gegangen war.
Sie erinnerte sich noch genau, wie sie kurz in die Bibliothek gespäht, einen Blick in das Arbeitszimmer geworfen hatte und durch all die endlosen Korridore geschlichen war, bis ihr Weg sie schließlich – schicksalshaft, wie sie fand – hierhergeführt hatte. Genau hierher, wo sie auch jetzt stand, nur einen Schritt entfernt von dem Bildnis des jungen Viscounts. Damals wie heute waren es seine lachenden Augen, die ihren Blick als Erstes angezogen hatten. Augen voller Schabernack und verschmitzten Humors. Dann sein Mund, ein breiter, großzügiger Mund mit diesem sinnlichen Schwung der Oberlippe. Rabenschwarzes Haar, das ihm streng aus der mächtigen Stirn gebunden war. In entspannter Pose lehnte er an einem Baum, eine Vogelflinte lässig in der Armbeuge. Zu seinen Füßen zwei Spaniel, die bewundernd zu ihm aufsahen.
Wer könnte es ihnen verargen? Wahrscheinlich hatte sie ganz genauso dreingeschaut, als sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Vielleicht tat sie es ja immer noch. Unzählige Nächte hatte sie damit zugebracht, sein Bildnis anzusehen und von einem Mann zu träumen, der bis in ihr Innerstes blicken könnte, der sie sah und sie lieben würde für das, was sie wirklich war.
Auch in der Nacht ihres zwanzigsten Geburtstags hatte sie sich hier heruntergeschlichen. Ganz aufgeregt war sie gewesen und von dem Gefühl beseelt, dass sie an der Schwelle zu etwas Neuem, Wunderbarem stünde. Nachdem sie ihren ersten Kuss bekommen hatte, war sie hierhergekommen, um ihre Gefühle zu bedenken. Sonderbar, dass sie sich noch daran, nicht aber an das Gesicht des Jungen erinnern konnte, dessen Lippen den ihren so ungeübt begegnet waren. Und auch als Jeremy heimgekehrt war, gebrochen vom Krieg, hatte sie hier Zuflucht gefunden.
Beatrice warf einen letzten Blick auf diese verschmitzten schwarzen Augen, dann wandte sie sich ab. Fünf lange Jahre hatte sie das Bildnis eines Mannes angeschmachtet, war dieses Porträt Gegenstand ihrer Träume und Fantasien gewesen. Und jetzt lag der Mann leibhaftig nur zwei Stockwerke über ihr.
Die Frage war indes, ob er unter dem zotteligen Haar und dem verwilderten Bart, unter allem Elend und Wahn, wirklich derselbe Mann war, der vor langer Zeit für dieses Bildnis gesessen hatte?
2. Kapitel
Nun begab es sich, dass der Koboldkönig Longsword schon lange sein magisches Schwert geneidet hatte, denn Kobolde geben sich nie mit dem zufrieden, was sie haben. Bei Einbruch der Dämmerung tauchte der Koboldkönig, in einen weiten, wallenden Samtumhang gehüllt, vor Longsword am Wegesrand auf.
Er verneigte sich und sprach: „Mein Herr, in dieser Börse trage ich dreißig Goldtaler bei mir, die Euch gehören sollen, wenn Ihr mir Euer Schwert lasst.“
„Bitte verzeiht, Sir, aber von meinem Schwert werde ich mich nicht trennen“, erwiderte Longsword.
Da kniff der Koboldkönig zornig die kleinen Äuglein zusammen …
Aus der Legende von Longsword
Ihre braunen Augen starrten ihn an aus einer Maske aus Blut, leblos und tot. Er war zu spät gekommen.
Reynaud St. Aubyn, Viscount Hope, erwachte mit pochendem Herzen, doch er rührte sich nicht und ließ sich nicht anmerken, dass er seine Umgebung genau registrierte. Reglos lag er da, atmete gleichmäßig weiter und sondierte die Lage. Seine Arme lagen seitlich am Körper, was bedeutete, dass sie seine Hände nicht wie sonst an den Pfahl gebunden hatten. Sehr leichtsinnig von ihnen. Er würde sich ganz ruhig verhalten, abwarten, bis alle eingeschlafen waren, und dann sein Messer nehmen, die alte Decke und das Trockenfleisch, das er gehortet und neben dem Wigwam im Boden vergraben hatte. Diesmal wäre er weit fort, wenn sie aufwachten. Diesmal …
Aber irgendetwas stimmte nicht.
Vorsichtig atmete er ein und roch … Brot? Er schlug die matten Augen auf. Alles um ihn her drehte sich, schwankte zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Einen Moment war ihm, als müsse er sich übergeben, dann beruhigte er sich und konnte alles deutlich sehen.
Er erkannte das Zimmer wieder.
Reynaud blinzelte verwirrt. Das Rote Zimmer. Im Haus seines Vaters. Dort war das hohe Fenster mit seinen verblichenen roten Draperien, durch das heller Sonnenschein hereinfiel. Die Wände waren mit dunklem Holz getäfelt, und ein Gemälde – das einzige im ganzen Zimmer – überdimensionierter rosa Rosen schmückte die Wand neben dem Fenster. Darunter stand der straff gepolsterte Tudor-Sessel, den seine Mutter gehasst hatte, den hinauszuwerfen sein Vater aber verboten hatte, da angeblich Heinrich VIII. einst darauf gesessen habe. Mutter hatte ihn ein Jahr vor ihrem Tod in dieses Zimmer verbannt, und Vater hatte es danach nie über sich gebracht, ihn wieder woanders hinzustellen. Jetzt lag Reynauds blauer Rock sorgsam zusammengefaltet darauf. Und neben seinem Bett standen auf einem kleinen Tisch ein Teller mit zwei Brötchen und ein Glas Wasser.
Ungläubig starrte er das Essen an und wartete nur darauf, dass es wieder verschwand. Zu oft schon hatte er von Brot und Wein und Fleisch geträumt, Träume, die sich beim Erwachen jedes Mal in Luft aufgelöst hatten, weshalb er seinen Augen auch jetzt kaum trauen mochte. Als die Brötchen nach einer Weile immer noch dort lagen, stürzte er sich darauf, riss das Brot mit seinen mageren Fingern in Stücke, die er sich gierig in den Mund stopfte. Kauend blickte er sich um.
Er lag in einem altertümlichen Bett, das einst für einen kurzleibigen Ahnen gefertigt worden war. Seine Füße hingen am Fußende heraus, aber immerhin war es ein Bett. Er strich über die roten Laken, die bestickte Bettdecke und hätte sich wieder nicht gewundert, wenn alles sich gleich einem Fiebertraum auflöste. Seit über sieben Jahren hatte er nicht mehr in einem richtigen Bett geschlafen. Es war ein seltsames Gefühl. Er war es gewohnt, auf der nackten Erde zu schlafen – oder trockenem Gras, wenn er Glück hatte – und sich mit räudigen Fellen zuzudecken. Seine rauen, verhornten Fingerkuppen strichen andächtig über den glatten Seidenstoff. Er konnte all das kaum glauben, doch es schien wahr.
Er war zu Hause.
Ein Gefühl des Triumphs durchströmte ihn. Monate beschwerlichen Reisens lagen hinter ihm, meist war er zu Fuß unterwegs gewesen, ohne Geld, ohne Freunde, ohne Einfluss. Die letzten Wochen dann noch das schreckliche Fieber und die Furcht, dass er so kurz vor dem Ziel noch scheitern könnte. Alles überstanden. Endlich. Er hatte es geschafft. Er war zu Hause.
Reynaud streckte die Hand nach dem Wasserglas aus und verzog gequält das Gesicht. Jeder Muskel schmerzte ihm. Seine Hand zitterte so heftig, dass er Wasser verschüttete, aber es war noch ein genügend großer Schluck darin, das trockene Brot herunterzuspülen. Mit den mühsamen Bewegungen eines alten Mannes schob er die Bettdecke von sich und stellte beruhigt fest, dass er seine Lederhosen und sein Hemd trug. Irgendjemand musste ihm indes seine Mokassins ausgezogen haben. Panisch sah er sich nach ihnen um – es waren seine einzigen Schuhe – und stellte dann fest, dass sie unter dem ungeliebten Tudor-Stuhl standen, auf dem auch sein Rock lag.
Vorsichtig setzte er sich auf, stellte die Füße auf den Boden und stand schwer atmend auf. Verdammt! Wo war sein Messer? Er war zu geschwächt, als dass er sich ohne es hätte verteidigen können. Er musste es finden. Doch zunächst suchte er den Nachttopf und machte von ihm regen Gebrauch. Dann ging er mit schweren Schritten zu dem Stuhl, auf dem seine Sachen lagen. Unter seinem Rock fand er schließlich sein Messer. Den vertrauten, abgenutzten Horngriff in der Hand zu spüren, ließ ihn sogleich ruhiger werden.
Barfuß tappte er zurück ans Bett, nahm sich das zweite Brötchen und steckte es ein. Dann ging er zur Tür. Jeder Schritt strengte ihn so sehr an, dass ihm der Schweiß auf der Stirn ausbrach, doch er mühte sich, keinen Laut von sich zu geben. Besser war es, man ließ Vorsicht walten. Sieben Jahre Gefangenschaft hatten ihn gelehrt, dass auf nichts Verlass war. Man musste jederzeit auf alles gefasst, immer auf der Hut sein.
Und so wunderte es ihn auch nicht, dass vor der Tür seines Zimmers ein livrierter Lakai stand. Etwas irritiert war er indes, als der Mann ihm dreist den Weg verstellte.
Reynaud hob stumm eine Braue und bedachte den Diener mit einem Blick, der dort, woher er kam, sein Gegenüber sofort zur Waffe hätte greifen lassen. Doch dieser unbedarfte Junge schien sein Lebtag noch keiner Gefahr ins Gesicht geblickt zu haben und hatte wohl noch nie um sein Essen kämpfen müssen. Er erkannte die Gefahr nicht, selbst als sie ihm direkt ins Auge schaute.
„Sie dürfen das Zimmer nicht verlassen, Sir.“
„Sors de mon chemin!“
Der Diener sah ihn mit großen Augen an, und erst da wurde Reynaud bewusst, dass er Französisch gesprochen hatte, jene Sprache, derer er sich die letzten sieben Jahre fast ausschließlich bedient hatte. „Lächerlich“, sagte er mit rauer Stimme. Das Englische war ihm so fremd geworden, dass es ihm nur schwer über die Lippen wollte. „Ich bin Lord Hope. Lassen Sie mich vorbei.“
„Miss Corning hat gesagt, Sie sollen auf dem Zimmer bleiben“, erwiderte der Diener, warf einen argwöhnischen Blick auf das Messer und schluckte schwer. „Sie hat strikte Anweisungen gegeben.“
Reynaud schloss seine Hand fester um das Messer und machte Anstalten, den Diener einfach aus dem Weg zu stoßen. „Und wer zum Teufel ist Miss Corning?“
„Das bin ich“, ließ eine Frauenstimme sich hinter dem Diener vernehmen. Reynaud hielt inne. Sie klang leise, lieblich und schrecklich kultiviert. Es war sehr lange her, dass er Englisch zuletzt so gesprochen gehört hatte. Und diese Stimme … Für eine solche Stimme würde er Berge versetzen und über Leichen gehen. Vielleicht ließe sie ihn gar vergessen, wofür er so lange gekämpft hatte. Es war eine ausgesprochen verlockende Stimme.
Sie erschien ihm wie das Leben selbst.
Ein kleines Persönchen spähte an dem Diener vorbei. „Wenn Sie gestatten?“
Reynaud runzelte die Stirn. Irgendwie war sie nicht ganz das, was er erwartet hatte. Sie war von mittlerer Gestalt, mit goldblondem Haar, heller Haut und einem freundlichen Antlitz. Ihre Augen waren groß und grau. Sehr englisch sah sie aus, was sie in seinen Augen geradezu exotisch erscheinen ließ. Nein, so konnte man das nicht sagen. Er versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Nicht sie war exotisch, er war einfach den Anblick einer blassen blonden Frau nicht mehr gewohnt. Einer Engländerin.
„Wer sind Sie?“, wollte er wissen.
Ihre hellen Brauen schossen in die Höhe. „Ich dachte, das hätten wir eben geklärt. Verzeihen Sie. Ich bin Beatrice Corning. Wie geht es Ihnen?“
Sie knickste so förmlich vor ihm, als begegneten sie einander im Ballsaal.
Er wollte verdammt sein, wenn er sich vor ihr verneigte. Auch so konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Er machte einen Schritt vor, wollte an dem jungen Ding vorbei. „Ich bin Hope. Wo ist mein …“
Doch sie fasste ihn beim Arm, und die leichte Berührung ließ ihn erstarren. Plötzlich waren seine Gedanken erfüllt von ausschweifenden Bildern ihrer wohlgerundeten Gestalt, er sah sie unter sich liegen und sich fest an ihren weichen Körper drängen. Wie kam er nur auf solche Fantasien? Das konnte unmöglich eine wahre Erinnerung sein. Delirierte er noch immer? Aber sein Körper schien den ihren zu kennen.
„Sie waren krank“, sagte sie so langsam und deutlich, als spräche sie mit einem kleinen Kind oder dem Dorftrottel.
„Ich …“, setzte er an, doch da schob sie ihn schon sanft, aber entschieden zurück ins Zimmer. Wollte er jetzt noch entkommen, müsste er sich an ihr vorbeidrängen. Er wollte ihr jedoch nicht wehtun.
Alles in ihm sträubte sich bei der bloßen Vorstellung, ihr etwas zuleide zu tun.
Und so ließ er sich von ihr ganz langsam und behutsam zurück in das Rote Zimmer manövrieren, bis er schließlich wieder neben dem Bett stand und sie ein wenig belustigt ansah.
Wer war diese Person?
„Wer sind Sie?“, fragte er noch einmal.
Besorgt legte sie die Stirn in Falten. „Erinnern Sie sich nicht mehr? Ich sagte es Ihnen bereits. Ich bin Beatrice …“
„Corning“, schloss er ungeduldig. „Ja, so viel habe ich verstanden. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, was Sie im Haus meines Vaters zu suchen haben.“
Leiser Argwohn huschte über ihr Gesicht, so flüchtig, dass er es sich auch hätte einbilden können. Aber nein, das hatte er nicht. Er spürte, dass sie etwas vor ihm zu verbergen suchte, und schon waren all seine Sinne hellwach. Beunruhigt sah er sich im Zimmer nach einer Fluchtmöglichkeit um. Wenn der Feind jetzt zuschlug, säße er in der Falle. Er würde sich an ihr vorbei zur Tür durchkämpfen müssen, aber viel Platz für Manöver blieb nicht.
„Ich lebe hier mit meinem Onkel“, sagte sie so beschwichtigend, als hätte sie seine Gedanken gelesen. „Können Sie mir erzählen, wo Sie waren? Was Ihnen zugestoßen ist?“
„Nein.“ Braune Augen, die ihn anstarrten durch eine Maske aus Blut, leblos und tot. Heftig schüttelte er den Kopf, um die Geister zu vertreiben. „Nein!“
„Schon gut.“ Ihre grauen Augen weiteten sich in sichtlicher Besorgnis. „Sie brauchen es mir nicht zu erzählen. Wenn Sie sich jetzt bitte wieder hinlegen würden …“
„Wer ist Ihr Onkel?“ Er ahnte unmittelbare Gefahr und spürte, wie sich ihm die Haare sträubten.
Sie schloss kurz die Augen, dann sah sie ihn direkt an. „Mein Onkel ist Reginald St. Aubyn, der Earl of Blanchard.“
Er schloss seine Hand fester um das Messer. „Was?“
„Es tut mir leid“, sagte sie. „Sie sollten sich jetzt wieder hinlegen.“
Er packte sie beim Arm. „Was haben Sie da eben gesagt?“
Sie fuhr sich kurz über die Lippen, und der Anblick ihrer rosigen Zungenspitze brachte ihn für einen Augenblick auf völlig andere Gedanken. Zarter Blumengeruch stieg ihm in die Nase, so fein und betörend …
„Ihr Vater ist vor fünf Jahren gestorben“, hörte er sie sagen. „Man hat Sie tot geglaubt, weshalb mein Onkel den Titel beansprucht hat.“
Doch nicht zu Hause, dachte er bitter. Ganz und gar nicht zu Hause.
„Oje, das muss ja schrecklich unangenehm für dich gewesen sein“, sagte Lottie am folgenden Nachmittag, unverblümt wie immer.
„Es war furchtbar.“ Beatrice seufzte. „Er hatte natürlich nicht die geringste Ahnung, dass sein Vater nicht mehr lebt, und dann hatte er noch dazu dieses große Messer in der Hand. Ich war ziemlich nervös und fürchtete fast, er könne gewalttätig werden, doch stattdessen wurde er plötzlich ganz still, was vielleicht noch schlimmer war.“
Beatrice runzelte die Stirn und entsann sich des plötzlichen Mitgefühls, das sie für Lord Hope empfunden hatte. Sie sollte kein Mitleid mit diesem Mann haben, der Onkel Reggie um seinen Titel und ihr Zuhause bringen könnte, aber so war es nun einmal. Sie konnte nicht anders. Sein Verlust hatte sie zutiefst berührt.
Sie trank einen Schluck Tee. Bei Lottie gab es immer so guten Tee – wohlschmeckend und stark –, was vielleicht auch ein Grund dafür war, weshalb Beatrice es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, jeden Dienstagnachmittag im Haus der Grahams vorbeizuschauen, auf eine Tasse Tee und den neuesten Klatsch und Tratsch. Auch Lotties privater Salon war einen Besuch wert, sehr elegant in einem dunklen Rosé gehalten und einem gräulichen Grünton, der einem auf den ersten Blick fad erscheinen mochte, das Rosé jedoch bestens zur Geltung brachte. Lottie verstand sich ganz ausgezeichnet auf Farben und Formen und sah selbst auch immer so schick und elegant aus, dass Beatrice sich manchmal fragte, ob ihre Freundin sich Pan, den kleinen weißen Spitz, nur deshalb zugelegt hatte, weil auch er so perfekt ins Bild passte.
Beatrice betrachtete Pan, der wie ein kleiner Fellteppich zu ihren Füßen lag und auf Kekskrümel lauerte.
„Stille Wasser sind tief“, bemerkte Lottie und gab sich ein kleines Stück Zucker in den Tee.
Beatrice hatte den Gesprächsfaden verloren und brauchte einen Moment, um sich zu besinnen, bevor sie erwiderte: „Bei seinem ersten Auftreten war er alles andere als still.“
„Das stimmt allerdings.“ Lottie nickte zufrieden. „Ich dachte wirklich, er wolle dir an die Gurgel gehen.“
„Die Aussicht scheint dich in helle Aufregung zu versetzen“, bemerkte Beatrice.
„Allerdings. Ich hätte das nächste Jahr auf jeder Dinnerparty etwas zu erzählen gehabt“, gestand Lottie ohne jeden Anflug von Scham. Sie nippte an ihrem Tee, krauste die Nase und gab noch ein winziges Stück Zucker in die Tasse. „Drei Tage ist es nun her, und man redet von nichts anderem mehr als vom verschollenen Earl und davon, wie er in den politischen Salon deines Onkels geplatzt ist.“
„Onkel Reggie fürchtet, wir könnten zum Stadtgespräch werden.“
„Da fürchtet er ausnahmsweise mal ganz recht.“ Lottie kostete erneut von ihrem Tee, der nun zu munden schien. Lächelnd stellte sie ihre Tasse ab. „Und jetzt verrat mir eines: Ist er nun Lord Hope oder ist er es nicht?“
„Ich glaube schon, dass er es ist“, sagte Beatrice vorsichtig und nahm einen Keks von der silbernen Servierplatte, die auf dem winzigen Tischchen zwischen ihnen stand. Pan hob frohlockend den Kopf und ließ ihre Hand nicht aus den Augen, als sie den Keks von der Platte auf ihren Teller beförderte. „Aber bislang hat noch niemand seine Identität bestätigt.“
Lottie war ihrerseits in die Keksplatte vertieft gewesen und blickte nun auf. „Wie denn, gar niemand? Er hat doch eine Schwester, oder?“
„Sie lebt in den amerikanischen Kolonien.“ Beatrice biss in ihr Gebäck und fügte hinzu: „Es soll auch noch eine Tante geben, aber die scheint auch außer Landes zu weilen. Ihr Butler gab sich sehr unbestimmt. Und Onkel Reggie meinte zwar, Hope früher schon begegnet zu sein, aber da sei der Viscount eben noch ein Junge von vielleicht zehn Jahren gewesen. Das hilft uns also auch nicht weiter.“
„Ja, aber was ist denn mit seinen Freunden?“, fragte Lottie.
„Er ist noch zu krank, um auszugehen.“ Beatrice presste die Lippen zusammen. Leicht war es nicht gewesen, Lord Hope heute früh davon zu überzeugen, dass er besser auf seinem Zimmer bliebe. „Aber wir haben zwischenzeitlich Viscount Vale benachrichtigt. Er ist einer der Gentlemen, die Hopes Tod mit eigenen Augen gesehen haben wollen.“
„Und?“
Beatrice zuckte mit den Schultern. „Er weilt gerade auf dem Land. Es kann noch Tage dauern, bis er zurückkommt in die Stadt.“
„Na dann! Dann darfst du dich jetzt weiter um deinen unverschämt gut aussehenden Patienten kümmern – der entweder ein seit Jahren verschollener Earl ist oder aber ein vagabundierender Schuft, der es auf deine Tugend abgesehen hat. Oder gar beides! Ich muss gestehen, ich bin furchtbar neidisch.“
Beatrice senkte den Blick und beobachtete Pan, der ein Stückchen Zucker neben ihrem Stuhl entdeckt hatte. Bei Lotties Worten musste sie sogleich wieder daran denken, wie der Viscount sich auf sie gestürzt und wie schwer sein Leib auf dem ihren gelegen hatte. Ganz kurz nur, für den Bruchteil einer Sekunde vielleicht, hatte sie beinahe um ihr Leben gebangt.
„Beatrice?“
Oje. Lottie hatte sich kerzengerade aufgesetzt, und am leisen Beben ihrer Nasenflügel konnte man förmlich sehen, wie sie Witterung aufgenommen hatte.
Beatrice gab sich unbeteiligt. „Ja?“
„Jetzt komm mir nicht so, Beatrice Rosemary Corning. Du klingst, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber ich durchschaue dich! Was ist passiert?“
„Nun ja …“ Beatrice verzog das Gesicht. „Er war an jenem Nachmittag noch etwas fiebrig, vermutlich hat er deliriert …“
„Ja-aa?“
„Und als wir ihn nach oben ins Bett brachten …“
„Du hast ihn zu Bett gebracht?“
„Es war wirklich nicht seine Schuld …“
„Oh, mein Gott, das wird ja immer besser!“
„Aber irgendwie hat er mich mit sich aufs Bett gezogen.“ Beatrice warf einen kurzen Blick auf Lottie, die in heller Erregung lauschte. Dann schloss sie die Augen und sagte tonlos: „Und dann lag er plötzlich auf mir.“
Totenstille.
Beatrice blinzelte vorsichtig.
Lottie saß mit großen Augen da und schien – ausnahmsweise einmal – sprachlos zu sein.
„Es ist aber wirklich nichts passiert“, beeilte sich Beatrice zu sagen.
„Nichts passiert“, hauchte Lottie. „Er hat dich kompromittiert!“
„Nein, hat er nicht. Es waren Diener dabei.“
„Diener zählen nicht“, beschied Lottie, stand auf und zog energisch an der Klingelschnur.
„Natürlich zählen sie“, sagte Beatrice. „Es waren sogar drei an der Zahl. Was hast du vor?“
„Ich läute nach mehr Tee.“ Lottie warf einen prüfenden Blick auf das schon gut geleerte Teetablett. „Und Keksen.“
Verlegen betrachtete Beatrice ihre Hände. „Die Sache ist die …“
„Ja?“
Beatrice holte tief Luft. „Er hat mir ehrlich gesagt ziemlich Angst eingejagt, Lottie.“
Lottie wirkte auf einmal recht ernüchtert und setzte sich. „Hat er dir wehgetan?“
„Nein. Zumindest nicht …“ Beatrice schüttelte den Kopf. „Einen Moment lang habe ich kaum Luft bekommen. Aber das meine ich nicht. Es war sein Blick, der Ausdruck in seinen Augen. Als würde er mich am liebsten … umbringen.“ Sie zog die Nase kraus. „Du musst mich für sehr töricht halten.“
„Aber natürlich nicht, meine Liebe.“ Lottie zögerte kurz. „Bist du dir sicher, dass es nicht gefährlich ist, ihn im Haus deines Onkels zu haben?“
„Ich weiß es nicht“, gab Beatrice zu. „Doch was sollen wir sonst tun? Wenn wir ihn auf die Straße setzen, und es sollte sich erweisen, dass er wirklich der Earl ist, würden wir uns damit keinen Gefallen tun. Er könnte gar einen Prozess gegen meinen Onkel anstrengen. Sicherheitshalber habe ich aber Wachen an seiner Tür postieren lassen.“
„Sehr vernünftig“, befand Lottie, sah aber noch immer besorgt drein. „Hast du dir schon überlegt, was du tun wirst, falls er der Earl ist?“
In diesem Augenblick kam das Mädchen herein, was Lottie ablenkte und Beatrice eine Antwort vorerst ersparte. Die Wahrheit war, dass es ihr ganz bang und beklommen ums Herz wurde, wenn sie nur daran dachte, was die Zukunft bringen würde.
Sollte der Mann im Roten Gemach wirklich Viscount Hope sein und sollte es ihm gelingen, seinen Titel zurückzugewinnen, dann stünden sie und Onkel Reggie ohne ein Dach über dem Kopf da. Sie würden ihr Einkommen, alle Besitzungen und Güter verlieren sowie all die Vorzüge, an die sie sich während der letzten fünf Jahre gewöhnt hatten, und Onkel Reggie würde das gar schrecklich zusetzen. Was mochte diese Situation mit ihm anrichten? Auch wenn er noch so sehr beteuerte, dass sein kleiner Anfall, wie er es nannte, nicht der Rede wert gewesen sei, so hatte sie doch noch sein bleiches, schweißnasses Gesicht in Erinnerung und würde nie vergessen, wie verzweifelt er nach Luft gerungen hatte. Allein der Gedanke genügte, dass sie sich ans Herz fasste. Gütiger Gott, nein, Onkel Reggie durfte sie nicht auch noch verlieren.
Sie mochte gar nicht daran denken und wollte wahrlich nicht darüber sprechen.
Und so lächelte Beatrice, als Lottie sich wieder auf ihr exquisites weiß-rosa gestreiftes Sofa plumpsen ließ und sie erwartungsvoll ansah. „Aber ich hatte angenommen, wir würden heute über Mr Graham und das Gesetz zur Versorgung der Veteranen reden. Wie ich gehört habe, will Mr Wheaton noch ein weiteres vertrauliches Treffen anberaumen, ehe …“
„Ach, wen interessieren schon Nate und die Veteranen?“ Lottie zog sich ein mit goldenen Fransen besetztes Seidenkissen auf den Schoß und drückte es an sich. „Ich bin es leid mit der Politik – und mit Ehemännern ebenso.“
Wieder kam das Mädchen – diesmal mit einem frisch beladenen Teetablett –, und während Tee und Gebäck aufgetragen wurden, hatte Beatrice Gelegenheit, ihre Freundin in Ruhe zu beobachten. Lottie sprach immer so leichthin über ihre Ehe, aber so langsam beschlich Beatrice das Gefühl, dass es zwischen ihrer Freundin und Mr Graham nicht zum Besten stand. Die Verbindung war für alle Seiten von Nutzen. Nathan Graham war der Spross einer recht vermögenden, wenngleich neureichen Familie, und Lottie stammte aus altem, doch verarmtem Adel. Eine aus praktischen Erwägungen geschlossene Ehe, mochte man meinen, aber Beatrice hatte immer den Eindruck gehabt, dass es doch auch eine Liebesheirat gewesen war – zumindest von Lotties Seite. Sollte sie sich getäuscht haben?
Als das Mädchen wieder fort war, sagte Beatrice sanft: „Lottie …“
Ihre Freundin goss Tee ein und hielt den Blick konzentriert auf die Kanne gerichtet. „Hast du schon gehört, dass Lady Hasselthorpe gestern auf dem Musikabend der Fotherings Mrs Hunt keines Blickes gewürdigt haben soll? Man munkelt schon, es könne ein erstes Anzeichen dafür sein, dass Mr Hunt nicht mehr in Lord Hasselthorpes Gunst stehe, aber so wie ich Lady Hasselthorpe kenne, könnte sie es schlichtweg aus Versehen getan haben. Sie ist ja so ein Spatzenhirn.“
Lottie reichte ihr eine frisch gefüllte Tasse, und vielleicht bildete Beatrice es sich ja nur ein, aber ihr war, als sähe ihre Freundin sie fast flehentlich an, es dabei zu belassen. Und was konnte sie schon tun? Mit ihren vierundzwanzig Jahren hatte sie ihr Lebtag noch keinen Antrag bekommen. Was konnte sie also schon über Herzensangelegenheiten wissen?
Mit einem stummen Seufzer nahm Beatrice die Tasse entgegen. „Und wie hat Mrs Hunt reagiert?“
Das Problem mit der Ehe, so dachte Lottie Graham wenig später, ist der Unterschied zwischen dem, was man sich erträumt hat und … nun ja, der ernüchternden Wirklichkeit.
Lottie ließ sich wieder auf das gestreifte Sofa sinken – von Wallace and Sons, erst im vergangenen Jahr angeschafft für eine wahrlich skandalöse Summe – und starrte auf das Teegedeck. Nachdem sie ihre beste und liebste Freundin eine halbe Stunde damit gelangweilt hatte, furchtbar belangloses Zeug zu reden, hatte sie Beatrice eben verabschiedet. Die Arme! Gewiss bereute sie es längst aus tiefstem Herzen, einmal die Woche zum Tee zu kommen und sich ihr dummes Geschwätz anzuhören.
Lottie seufzte schwer und nahm sich das letzte Gebäckstück. Pan, ihr kleiner Liebling, kam angesprungen, setzte sich zu ihren Füßen und schaute hoffnungsfroh zu ihr auf.
„Das ist gar nicht gut für dich, so viel Süßes“, meinte Lottie tadelnd und gab ihm den Keks dennoch. Geschickt nahm das Hundchen ihn zwischen die scharfen kleinen Zähne und zog sich mit seiner Beute unter einen vergoldeten französischen Sessel zurück.
Ermattet ließ sich Lottie zurücksinken, einen Arm über die Lehne drapiert. Vielleicht erwartete sie ja zu viel. Vielleicht waren das ja alles nur dumme Mädchenträume, denen sie längst hätte entwachsen sein sollen. Vielleicht endeten ja alle Ehen, selbst die besten wie die ihrer Mama und ihres Papas, irgendwann in dieser Gleichgültigkeit, und sie war einfach nur töricht, mehr zu erwarten. Genauso ein Spatzenhirn wie Lady Hasselthorpe.
Das Mädchen Annie kam herein, um das Teegedeck abzuräumen. Nach einem kurzen Blick auf Lottie fragte sie zaghaft: „Kann ich noch etwas für Sie tun, Ma’am?“
Oh Gott, nein, selbst die Dienstboten schienen es schon zu spüren!
Lottie setzte sich ein wenig auf und gab sich den Anschein der Gelassenheit. „Nein, das wäre dann alles.“
„Ja, Ma’am.“ Annie knickste. „Die Köchin lässt fragen, ob heute Abend ein oder zwei Gedecke aufgetragen werden sollen?“
„Nur ein Gedeck, danke“, murmelte Lottie und wandte sich ab.
Leise verließ Annie den Raum.
Eine ganze Weile saß Lottie so da, lustlos auf dem Sofa hindrapiert, und erging sich in allerlei aufrührerischen Gedanken, bis abermals die Tür aufging.
Nate kam hereinspaziert und blieb wie angewurzelt stehen, als er sie sah. „Oh, entschuldige, Liebes! Lass dich nicht von mir stören. Ich dachte, dass niemand hier wäre.“
Als er Nates Stimme hörte, kam Pan unter seinem Sesselchen hervor und lief zu seinem Herrchen, um sich streicheln zu lassen. Pan hatte Nate vom ersten Augenblick an vergöttert.
Lottie hätte ihrem Hund am liebsten die Zunge rausgestreckt. Stattdessen sagte sie so beiläufig wie möglich: „Ich wusste nicht, dass du heute zum Essen zu Hause bist. Eben hatte ich der Köchin ausrichten lassen, sie brauche nur ein Gedeck aufzutragen.“
„Schon recht.“ Nate kraulte Pan und richtete sich wieder auf, um sie mit seinem strahlenden, unverbindlichen Lächeln zu bedenken – jenem Lächeln, das ihr törichtes Herz zuallererst hatte höherschlagen lassen. „Ich werde mit Collins und Rupert dinieren. Ich wollte nur eben schauen, ob ich dieses Pamphlet der Whigs hier habe liegen lassen … Rupert wollte es sich ansehen. Ah, das ist es ja!“
Nate eilte zu einem Tisch in der Ecke, auf dem sich Stapel von Papieren türmten, schnappte sich besagtes Pamphlet und schien sichtlich zufrieden, gefunden zu haben, weswegen er gekommen war. Ganz in das Flugblatt vertieft, ging er wieder hinaus, und, schon an der Tür, drehte er sich noch einmal um, als sei ihm gerade etwas eingefallen.
Mit leiser Besorgnis sah er Lottie an. „Das ist doch in Ordnung, oder? Ich meine, dass ich mit Collins und Rupert diniere? Als ich die Verabredung traf, bin ich davon ausgegangen, du seist ebenfalls außer Haus.“
Lottie hob eine Braue. „Oh, sei unbesorgt. Ich …“
Doch sie sprach nur noch zu seinem Rücken.
„Gut, sehr gut. Ich wusste doch, du würdest es verstehen.“ Und schon war er verschwunden, die Nase längst wieder in dem vermaledeiten Pamphlet vergraben.
Lottie atmete tief aus und warf eines der kleinen Seidenkissen nach der Tür. Pan fuhr zusammen und winselte vor Schreck.
„Keine zwei Jahre verheiratet, und er diniert lieber mit zwei langweiligen alten Männern als mit mir!“
Pan sprang neben ihr aufs Sofa – was ihm strengstens verboten war – und leckte ihr die Nase.
Woraufhin Lottie in Tränen ausbrach.
Vierundzwanzig Jahre und noch keinen einzigen Antrag.
Der Gedanke wollte Beatrice den ganzen Heimweg über nicht mehr aus dem Sinn. Wie ein hämischer Spottgesang verfolgte er sie. Nie zuvor hatte sie es so unverblümt in Worte gefasst. Wo war die Zeit nur hin? Es war keineswegs so, dass sie ihre Tage in untätiger Muße verbracht und nur darauf gewartet hätte, dass der richtige Gentleman des Weges käme, auf dass ihr wahres Leben begänne. Nein, sie führte ein sehr erfülltes, geschäftiges Leben, rief sie sich – vielleicht eine Spur zu betont – in Erinnerung.
Onkel Reggie war seit zehn Jahren verwitwet, und so war sie an seiner Seite praktisch in die Rolle der Gastgeberin hineingewachsen. Sie gab politische Salons für ihn, Dinner, Abendgesellschaften, und den alljährlichen Ball nicht zu vergessen. All das mochte auf die Dauer ein wenig langweilig werden, wollte aber erst mal bewerkstelligt sein.
Und fairerweise musste man sagen, dass sie zumindest hofiert worden war. Im vorigen Frühjahr erst hatte Mr Matthew Horn durchaus Interesse an ihr bekundet – um sich dann wenig später eine Kugel durch den Kopf zu jagen, der arme Mann. Und einmal war sie einem Antrag ganz nah gekommen: Mr Freddy Finch – immerhin der jüngere Sohn eines Earls – hatte sie mit seinem schnittigen Aussehen und seinem Charme bezaubert und sie sehr lieb geküsst. Etliche Jahre war das schon her, doch hatte es fast eine ganze Saison gewährt. Sie hatte ihre Freude an den gemeinsamen Unternehmungen gehabt – hatte Freude an Freddy gehabt –, doch, wie ihr später aufging, keineswegs auf die Weise derer es bedurft hätte, um seinen Antrag anzunehmen.
Sie hatte sich auf die gemeinsamen Kutschfahrten gefreut, doch wenn er aus irgendeinem Grund absagen musste, hatte sich ihre Enttäuschung in Grenzen gehalten. Mit ihrer eigenen Halbherzigkeit hätte sie vielleicht leben können, doch hatte sie sich nie der Vermutung erwehren können, dass Freddys Gefühle kein bisschen mehr angerührt waren als die ihren, und das hätte sie in einer Ehe nicht ertragen. Wenn sie heiratete – wenn, wohlgemerkt –, dann einen Mann, der hemmungslos, leidenschaftlich in sie verliebt war.
Ein Mann, der sie nie verlassen würde.
Darum hatte sie sich von Freddy getrennt. Nicht auf dramatische Weise, sie hatte ihn einfach immer seltener gesehen, bis man sich dann ganz aus den Augen verloren hatte. Und wie es schien, hatte sie seine Gefühle ganz richtig eingeschätzt, denn Freddy hatte nicht ein einziges Mal gegen ihren Rückzug aufbegehrt. Stattdessen hatte er im Jahr darauf Guinevere Crestwood geheiratet, eine recht unscheinbare junge Dame, die jede Teegesellschaft mit militärischer Strenge führte.
War sie neidisch? Beatrice sah zum Kutschenfenster hinaus, während sie ihre Gefühle ganz ehrlich zu ergründen versuchte. Sie wollte sich nichts vormachen, jede Form der Täuschung war ihr zuwider. Aber nein, sie schüttelte den Kopf. Sie konnte ganz ehrlich von sich behaupten, keinen Neid auf die junge Mrs Finch zu verspüren, wenngleich ihre kleine Kinderschar schon sehr putzig war. Aber erstens würden die niedlichen Kinder eines Tages bestimmt Guineveres Pferdegebiss bekommen, und zweitens war Freddy zwar nett und charmant und auch recht ansehnlich gewesen, aber er hatte Beatrice nie geliebt. Vielleicht war Freddy ja in Liebe zu Guinevere entbrannt, aber Beatrice wagte, dies zu bezweifeln.
Und genau dort lag das Problem. Nicht ein einziger der Gentlemen, mit denen sie Kutschfahrten unternommen, Bälle besucht und durch den Park flaniert war, war ernstlich an ihr interessiert gewesen. Nicht ein einziger hatte tiefe, wahre Gefühle für sie gehegt. Sie hatten ihr artige Komplimente gemacht, ihre Roben bewundert, ihr beim Tanzen lächelnd in die Augen geblickt, sie aber nie – nicht ein einziges Mal – wirklich gesehen. Keiner von ihnen wusste, wer sie hinter der äußeren Fassade war. Guinevere Crestwood mochte eine Ehe ohne Leidenschaft vielleicht genügen, ihr jedoch nicht.
Sie erinnerte sich noch gut, wie sie vor einem Jahr wieder einmal enttäuscht von einem Ball heimgekehrt und geradewegs in den Blauen Salon gegangen war, zu Lord Hopes Porträt. Er schien so lebendig vor Leidenschaft. Allein sein Abbild genügte, alle anderen Gentlemen verblassen zu lassen. Selbst als sie ihn lang schon tot glaubte, schien er ihr noch immer leibhaftiger, lebendiger als alle Männer aus Fleisch und Blut, die sie Stunden zuvor hofiert hatten.
Vielleicht war das ja der wahre Grund, weshalb sie mit vierundzwanzig noch immer eine Jungfer war: Sie hatte auf einen Mann gewartet, der ebenso lebendig und leidenschaftlich war, wie sie sich Lord Hope erträumt hatte.
Doch war er dieser eine ersehnte Mann?
Die Kutsche hielt vor dem Haus der Blanchards, und Beatrice ließ sich von einem Lakaien den Kutschentritt hinabhelfen. Für gewöhnlich besprach sie um diese Zeit die wöchentliche Speisenfolge mit der Köchin. Heute jedoch bat sie nur darum, dass man ihr ein Tablett bereite und ließ die Köchin von ihren geänderten Plänen wissen. Kurz darauf ging sie, das Tablett in den Händen, hinauf zum Roten Gemach.
George, der vor der Tür Wache stand, nickte ihr zu. „Kann ich Ihnen das Tablett abnehmen, Miss?“
„Danke, George, das schaffe ich schon.“ Besorgt fragte sie: „Wie geht es ihm?“
George kratzte sich den Schädel. „Recht gereizt, Miss, wenn ich das so sagen darf. Hat ihm gar nicht gefallen, als das Mädchen heute früh rein ist, um Feuer zu machen. Hat sie ganz schön angeschrien, auf Französisch – glaub ich zumindest. Ich sprech das ja selbst nicht.“
Beatrice spitze die Lippen und nickte. „Könnten Sie für mich klopfen?“
„Natürlich, Miss.“ George hämmerte an die Tür.
„Herein“, rief Hope.
George hielt ihr die Tür auf, und Beatrice spähte ins Zimmer. In ein weites Nachthemd gekleidet, saß der Viscount aufrecht im Bett und schrieb in ein Notizbuch, das auf seinem Schoß lag, neben sich auf der Bettdecke das grässliche Messer. Nun denn, zumindest scheint er bei Sinnen und guter Verfassung, dachte Beatrice und atmete dankbar auf. Seine Wangen zeigten nicht mehr die fiebrige Röte, die sie die letzten beiden Tage gehabt hatten, auch wenn sie noch immer hager und ausgezehrt wirkten. Das lange schwarze Haar hatte er sich streng zurückgebunden, doch der wild wuchernde Bart stand ihm noch immer im Gesicht. Die obersten Knöpfe seines Nachthemds waren nicht geschlossen und ließen ein wenig dunkles Haar erkennen, das sich unter dem weißen Linnen krauste. Wie gebannt starrte Beatrice darauf.
„Um mein leibliches Wohl besorgt, Cousine Beatrice?“, fragte er anzüglich, und jäh riss sie ihren Blick von ihm los – nur um seinen wissenden schwarzen Augen zu begegnen.
„Ich habe Ihnen Tee und Gebäck gebracht“, erwiderte sie spitz. „Und Sie brauchen überhaupt nicht so unverschämt zu werden. Alle Dienstmädchen haben Sie schon in Angst und Schrecken versetzt. George hat mir erzählt, dass Sie heute früh erst eines angeschrien haben.“
„Weil es nicht geklopft hat.“ Er folgte jeder ihrer Bewegungen, als sie durch das Zimmer ging, um das Tablett neben seinem Bett auf den Tisch zu stellen.
„Das ist noch lange keinen Grund, ihr einen solchen Schrecken einzujagen.“
Gereizt wandte er sich ab. „Ich mag es nicht, wenn die Bedienten hier ein und aus gehen. Ohne Erlaubnis hätte sie nicht hereinkommen sollen.“
Beatrice’ Miene wurde milder, als sie ihn so ansah, ihre Stimme sanfter. „Die Dienstboten sind angehalten, nicht zu klopfen. Sie werden sich wohl daran gewöhnen müssen. Aber bis dahin werde ich Weisung geben, bei Ihnen eine Ausnahme zu machen.“
Er nahm es mit einem Achselzucken auf, nahm sich eins der Brötchen vom Tablett und stopfte sich eine Hälfte gleich in den Mund.
Seufzend zog sie sich einen Stuhl heran und setzte sich zu ihm ans Bett. „Sie scheinen großen Hunger zu haben.“
Er hielt kurz inne und schnappte sich dann das nächste Brötchen. „Sie hatten wahrscheinlich noch nie das Vergnügen, Schiffszwieback zu essen, in dem schon die Maden krabbeln, und wochenlang nichts anderes als verwässertes Bier zu trinken zu bekommen.“ Herzhaft biss er in das zweite Brötchen, seine schwarzen Augen herausfordernd auf sie gerichtet.
Ruhig sah sie ihn an und gab sich alle Mühe, ihr Unbehagen zu verbergen, welches sein Blick ihr verursachte. Seine Augen waren wie die eines wilden Tieres, eines hungrigen Wolfs. „Nein, ich war noch nie auf einem Schiff. Sind Sie kürzlich erst von Bord gegangen?“
Er sah beiseite und aß schweigend das Brötchen auf. Gerade als sie schon meinte, er würde ihre Frage nicht beantworten, lachte er bitter: „Ich habe mich während der Überfahrt als Küchenhilfe verdingt. Nicht, dass es viel gegeben hätte, womit man hätte kochen können.“
Fragend sah sie ihn an. Welche Not musste dem Sohn eines Earls widerfahren sein, dass er sich dazu genötigt sah, so niedere Arbeit anzunehmen? „Von wo aus sind Sie in See gestochen?“
Er verzog kurz das Gesicht, sah sie dann unter schwarzen Wimpern hervor an. „Wissen Sie, ich kann mich nicht entsinnen, überhaupt eine Cousine namens Beatrice gehabt zu haben.“
Gut, er schien wirklich nicht auf ihre Frage antworten zu wollen. Beatrice versagte sich einen resignierten Seufzer. „Das könnte daran liegen, dass ich gar nicht Ihre Cousine bin. Zumindest nicht in direkter Linie.“
Seine Frage mochte ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, doch nun sah er sie mit fragend geneigtem Kopf und sichtlichem Interesse an. „Das müssen Sie mir erklären.“
Er hatte sein Notizbuch beiseitegelegt und seine ganze Aufmerksamkeit ihr zugewandt, was sie recht verlegen machte. Beatrice stand auf und goss Tee ein, während sie zu erzählen begann. „Meine Mutter war die Schwester von Onkel Reggies Frau, meiner Tante Mary. Mutter starb bei meiner Geburt, und als ich fünf war, starb auch mein Vater. Tante Mary und Onkel Reggie haben mich bei sich aufgenommen.“
„Traurige Geschichte.“ Spöttisch hob er die Brauen.
„Keineswegs.“ Beatrice reichte ihm eine Tasse Tee ohne Milch, aber mit reichlich Zucker. „Ich bin immer geliebt, immer umsorgt worden, erst von meinem Vater, dann von Onkel Reggie und Tante Mary. Die beiden hatten selbst keine Kinder und behandelten mich wie ihre eigene Tochter, wenn nicht gar besser. Onkel Reggie war wunderbar zu mir.“ Ernst sah sie ihn an. „Er ist ein guter Mensch.“
„Dann sollte ich wohl auf meinen Titel verzichten und ihn Onkel Reggie überlassen“, sagte er, nun mit beißendem Spott.
„Sie brauchen gar nicht so garstig zu sein“, gab sie zurück.
„Ach nein?“ Er betrachtete sie, als würde er nicht so ganz schlau aus ihr.
„Nein, dazu gibt es keinen Grund. Es ist nur so, dass das jetzt unser Haus ist und wir seit fünf Jahren …“
„Und deshalb soll ich mich Ihrer erbarmen? Meine Waffen strecken und Frieden schließen?“
Sie holte tief Luft, um nicht die Beherrschung zu verlieren. „Mein Onkel ist nicht mehr der Jüngste. Er …“
„Mein Titel, meine Ländereien, mein Vermögen, mein ganzes gottverdammtes Leben ist mir gestohlen worden!“, rief er mit stetig lauter werdender Stimme. „Und da glauben Sie, ich würde mich auch nur einen Deut um Ihren wunderbaren Onkel scheren?“
Mit großen Augen sah sie ihn an. Wie zornig er war, wie entschlossen. Wo war der vergnügte junge Mann aus dem Gemälde geblieben? War er für immer verschwunden? „Sie galten als tot. Niemand hatte die Absicht, Sie um Ihren Titel zu bringen.“
„Ihre Absichten interessieren mich nicht“, entgegnete er. „Mich interessiert nur das Resultat. Man hat mir genommen, was von Rechts wegen mein ist. Ich habe nicht mal mehr ein Zuhause!“
„Aber dafür kann doch Onkel Reggie nichts!“, schrie sie ihn an und verlor endgültig die Beherrschung. „Ich versuche doch nur, Ihnen zu erklären, dass wir einander nicht bekämpfen müssen. Wir sind hier nicht im Krieg. Über alles kann man wie zivilisierte …“
Er schleuderte seine Teetasse gegen die Wand, dann fegte er mit einem jähen, ungestümen Armstreich über den Tisch. Beatrice sprang rasch beiseite, als Tablett, Teller, Teekanne – frisch gefüllt mit heißen Tee – vor ihren Füßen zu Boden krachten.
„Wie können Sie es wagen?“, fuhr sie ihn an und starrte ungläubig auf die Bescherung am Boden, dann auf den Wilden im Bett. „Wie können Sie es nur wagen?!“
Sein scharfer Blick schien durch ihre Haut zu schneiden. „Wenn Sie meinen, dass dies kein Krieg ist, Madam“, sagte er ruhig, „dann sind Sie noch naiver, als ich gedacht hätte.“
Beatrice stemmte die Hände in die Hüften und beugte sich vor. Ihre Stimme bebte vor Zorn. „Dann bin ich eben naiv. Vielleicht ist es ja dumm und unbedarft und … töricht von mir zu glauben, dass man Probleme auf zivilisierte Weise lösen kann. Aber lieber ein törichtes Frauenzimmer als ein garstiger, verbitterter Mann, der keinerlei Anstand und Menschlichkeit mehr kennt!“
Damit wollte sie auf dem Absatz kehrtmachen und aus dem Zimmer rauschen, aber er packte sie beim Handgelenk und hielt sie zurück. Sie geriet ins Straucheln und stürzte aufs Bett, geradewegs in seinen Schoß. Keuchend rang sie nach Luft und sah auf.
In glühende schwarze Augen.
Er war ihr so nah, dass sie seinen Atem auf ihren Lippen spüren konnte. Seine Schenkel spannte er an unter ihrer Hüfte, ließ sie sich damit ihrer heiklen Lage bewusst werden. Seine Hände schlossen sich fest um ihre Arme, hielten sie gefangen. „Dann bin ich eben ein garstiger, verbitterter, seines Anstands beraubter Mann, Madam“, zischte er. „Aber eins kann ich Ihnen versichern – meine Menschlichkeit ist noch mehr als intakt.“
Beatrice stockte der Atem; sie fühlte sich wie ein vom Wolf aufgeschrecktes Kaninchen. Plötzlich spürte sie die Wärme, die von seinem Körper ausging. Ihre Brust war fast an die seine gepresst, und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, senkte sein schwarzer Blick sich nun auch noch auf ihren Mund.
Wie gebannt sah sie, wie seine Lippen sich öffneten, seine Lider sich schlossen, dann hörte sie ihn mit leiser, fast drohender Stimme sagen: „Und ich werde alle mir verfügbaren Mittel einsetzen, um diesen Krieg zu gewinnen.“
So fasziniert war sie von den verwerflichen Absichten, die aus seinen Worten, seinen Augen sprachen, dass sie wie ertappt zusammenfuhr, als die Tür des geöffnet wurde. Lord Hope ließ von ihr ab und sah über ihre Schulter auf den Eindringling. Einen flüchtigen Moment glaubte sie, so etwas wie Freude über sein Antlitz huschen zu sehen, doch sie konnte sich auch getäuscht haben, so rasch war es wieder vorbei.
Als er sprach, waren seine Miene und seine Stimme wieder wie versteinert.
„Renshaw“, sagte er tonlos.